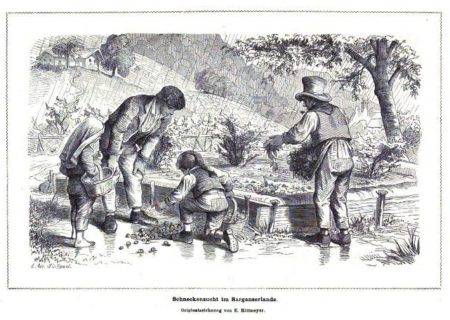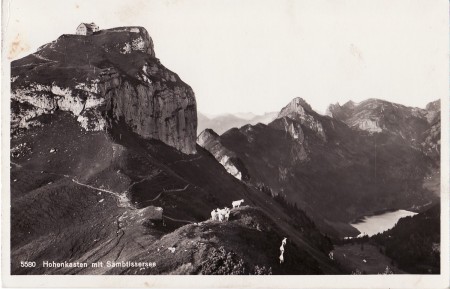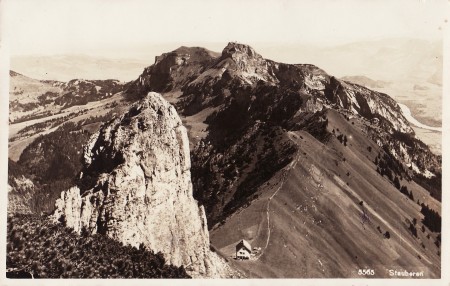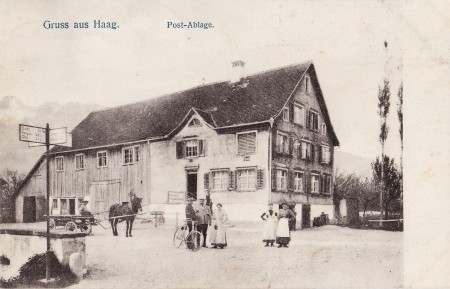(Auszug aus dem Appenzeller Kalender Ausgabe 1907, Titel „Üseri Puuresprooch“, Autor Dr. J. Vetsch, Redaktor am schweizerischen Idiotikon)
Die vielen Fremden, die alljährlich unser schönes Schweizerland besuchen, sind erstaunt über die ehrenvolle Stellung, die bei uns die Mundart einnimmt. Während sie andernorts nur noch im Verkehre der unteren Stände unter sich lebt, ist sie bei uns noch allgemeine Umgangssprache zwischen Gebildeten und Ungebildeten, Hoch und Niedrig, Reich und Arm. In dieser Tatsache liegt eine unserer schönsten nationalen Eigenheiten, die zu bewahren jedem echten Schweizer ans Herz gelegt werden sollte. …
Was gibt es Ehrwürdigeres, was ist inniger mit dem ganzen Wesen eines Volkes, seinem Ursprung und seiner Geschichte verknüpft, als die Mundart? Sie ist die Sprache der Kindheit, die Sprache unserer Väter….
Laute und Wörter haben sich von Generation zu Generation übertragen, von Mund zu Mund sind sie durch die Jahrhunderte gewandert auf einer langen, lebendigen Brücke bis zu uns. Wie das Kind sie von seiner Mutter, seinem Vater gehört hatte, so lernten es später wieder seine Kinder von ihm. Allein auf dieser langen Wanderung, wo die Träger immer wechselten, ist die Sprache nicht unverändert geblieben; sie hat sich so verändert, dass wir heute Mühe hätten, uns mit unseren Vorfahren vor tausend Jahren zu verständigen….
Vor allem floss die Rede zu jener Zeit viel langsamer dahin; das zeigen die vollen Laute a, o, i, u, die in den End- und Nebensilben gesprochen wurden. Schon einige Jahrhunderte später sind sie zu e abgeschwächt und in unserer heutigen Mundart vielfach ganz weggefallen. Wir sagen „hüt“ für „hiutu“, „regnet“ für „regenoot“, „Bömm“ für „Bauma“. Die Entwicklung der einzelnen Laute (Buchstaben) ist aber nicht eine regellose, sondern es lässt sich bei näherem Zusehen, wie bei den Veränderungen der Natur, eine bestimmte Gesetzmässigkeit erkennen. … war aber die Entwicklung nicht überall die gleiche… so finden sich überall, allerdings mehr oder weniger, Unterschiede in der Mundart sogar von Gemeinde zu Gemeinde.
Diese Sprachspaltung ist begründet in der geschichtlichen Entwicklung einer Gegend. Was Jahrhunderte lang kirchlich und politisch zusammengehörte, bildete ein Verkehrsgemeinschaft für sich und da war die Gelegenheit zu gesonderter sprachlicher Entwicklung gegeben, da eben ein reger Verkehr mit dem benachbarten Gebiete fehlte und ein sprachlicher Ausgleich daher nicht möglich war….
Wenn man den Lautstand einer Gegend ganz genau aufnimmt, d.h. an möglichst vielen Punkten die Aussprache aller Wörter abfragt,…, so erhält man die sprachlich zusammengehörigen Gebiete und für jeden Unterschied zwischen ihnen ganz genau die Grenzlinie, bis wohin man so sagt, und wo wieder anders, z.B. wo „nüd“ und wo „nöd“, oder wo „g’seit“ und wo „g’sääd“ oder „g’soat“ usw. …
Jedoch nicht nur die Aussprache der Wörter hat sich geändert, sondern oft auch deren Bedeutung und hier zeigt sich nun der Reichtum der Mundart gegenüber der Schriftsprache. …
Heute tut es wirklich not, alle die mundartlichen Schätze durch Aufzeichnung zu bergen. Jeder fühlt den zerstörenden Einfluss, den Schule und Verkehr auf die Volkssprache ausüben. Die Kinder reden nicht mehr wie die Eltern, geschweige wie ihre Grosseltern; mit jedem Greise, der ins Grab sinkt, verschwinden auf immer kostbare Überlieferungen, die in ihren Wurzeln viele Jahrhunderte zurückgehen.
Immer stärker werden die Einflüsse der Schriftsprache. Und doch wird uns diese nie die Mundart ersetzen können.
Eine allgemeine deutsche Schriftsprache gibt es erst seit ein paar Jahrhunderten und sie beruht auf der Mundart einer einzelnen Gegend, die dadurch allgemein geworden ist, dass Luther in ihr geschrieben hat. Durch seine Bibelübersetzung fand sie nach und nach überall Eingang. Auch die frühere Schriftsprache der Schweiz mit ihrem stark schweizerdeutschen Charakter wich dem Gemeindeutsch, und es ist wohl gut so.
Gewiss ist es heute für Jeden von grossem Wert für sein Fortkommen, wenn er in der Schule die Schriftsprache in Wort und Schrift möglichst beherrschen lernt. Allein diese wird uns nie ins Herz wachsen wie die Mundart, die viel reicher ist zum Ausdruck unseres Denkens und Fühlens. Geben wir sie wenigstens nicht leichtsinnig preis, sondern behalten wir ihr unsere Liebe und Achtung und tun wir unser Möglichstes, das mit ihr schwindende kostbare Gut durch Sammlung vor dem vollständigen Untergange zu bewahren.
interne Links: Wörtersammlung, Tonaufnahmen
Erfasst am Freitag, 13. Februar 2015 | Kommentare deaktiviert für Der Reichtum der Mundart